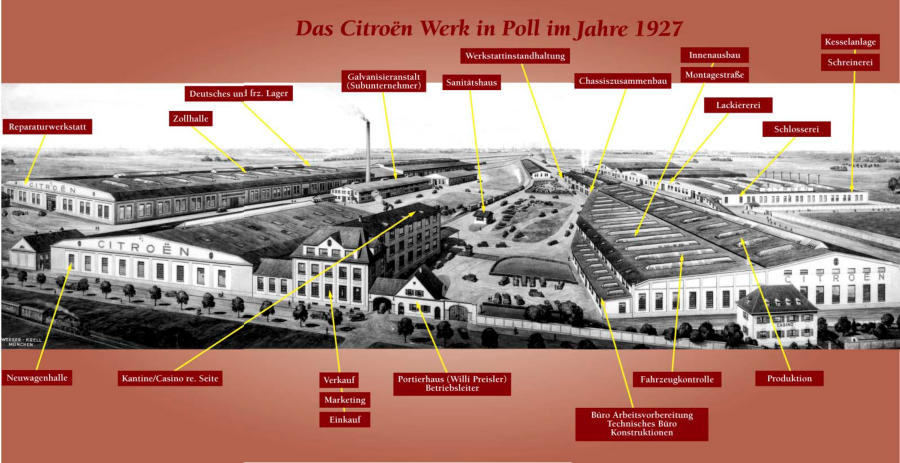© 2020 by Immo Mikloweit • WebDesign by www.tmg24.de

IMPRESSUM

90 Jahre Citroën
Seit 90 Jahren Citroën in Deutschland - Das bewegte Leben der Köln-Tochter
Chronologie eines denkwürdigen Stücks Automobil- und Europa-Geschichte
Das waren noch Zeiten, als sich die „französischste aller französischen Automarken“ genötigt sah, bei uns mit Slogans wie diesem zu
werben:
„Der neue 1,4 Liter Citroën, ganz deutsch! Deutscher Motor !
Deutsches Material“ Deutsche Arbeit!“
Und
als
ein
gelernter
Schlosser
am
Fließband
1,20
Mark
pro
Stunde
verdiente
und
sich
damit
schon
zu
den
Privilegierten
im
Landen
zählen
durfte.
Als
eine
Sechszylinder-Limousine,
die
aus
2,5
Litern
Hubraum
stolze
42
PS
holte,
dem
betuchten
Herrenfahrer
das
Benzin
im
Munde
zusammenlaufen
ließ,
wie
heute
ein
XM
oder
Xantia
V6.
Und
als
bereits
ein
Jahres-Verkaufsresultat
von
knapp
8000
Citroën-
Fahrzeugen in Deutschland die Pariser Zentrale in helles Entzücken versetzte......
Nein,
eine
„gute
alte“
Zeit
war
sie
unter
dem
Strich
gewiß
nicht,
die
erste
Epoche
der
Doppelwinkel-Präsenz
in
Deutschland
von
Januar
1927
bis
hinein
in
den
Zweiten
Weltkrieg.
Sondern
wechselvoll
turbulent
und
zuletzt
sogar
tragisch
-
wie
ja
eigentlich
nahezu
alles
in
jener
geschichtlichen
Scheinblüte
der
Endzwanziger.
Angefangen
hat
es
in
Köln
mit
einem
gewissen
Theodor
Prinz
um
1923
und
seiner
Generalvertretung für Citroën Fahrzeugen auf dem Hohenzollernring.
1927: In Deutschland fängt man an Citroën zu bauen:
André
Citroën
hat
das
legendäre
„Rheinwerk“
im
Kölner
Vorort
Poll
aufgekauft,
eine
ehemalige
Waggonfabrik
mit
Karosseriebau
sowie
Omnibusfertigung,
und
gründet
die
deutsche
Filiale
Citroën
Automobil
AG.
Sie
wird
am
8.
Januar
1927
ins
Kölner
Handelsregister
eingetragen.
Das
Aktienkapital
beträgt
anfangs
eine
Million
Reichsmark,
seinerzeit
eine
gewaltige
Summe;
es
liegt
zu
100
Prozent
in
den
Händen des französischen Mutterhauses.
Wie
bei
allen
Projekten,
die
er
anpackt,
macht
André
Citroën
auch
hier
Nägel
mit
Köpfen:
In
schier
atemberaubendem
Tempo
schreitet
die
Aus-
und
Umgestaltung
des
Poller
Areals
zu
einer
-für
damalige
Begriffe-
supermodernen
Fertigungsstätte
und
Vertriebzentrale
für
Autos
mit
dem
Doppelwinkel
voran.
Schon
im
April
werden
mit
einem
306
Mann
starken
Mitarbeiterstamm
von
auf
den
650
Meter
langen
Monta-gebändern
die
ersten
Exemplare
des
Modells
B
14
zusammengebaut.
Zum
Start
sind
es
drei
Stück
pro
Tag,
im
Sommer
bereits
25,
am Jahresende 34!
Von
vornherein
erhalten
die
Fahrzeuge
Innenausstattung
und
Außen-Finish
aus
selbständiger
Sattlerei
und
Lackiererei.
Ansonsten
kommen
die
technischen
Teile
zunächst
komplett
aus
Frankreich.
Das
soll
sich
jedoch
rasch
ändern:
Das
Kölner
Werk
übernimmt
immer
mehr
Produktionsarbeit
in
Eigenregie,
mit
immer
mehr
deutschen
Bauelementen
und
Materialien.
Und
selbstverständlich
sind
auch
die
anfangs
rund
500,
wenig
später
im
Jahre
1928
schon
circa
1000,
Angestellten
und
Arbeiter
durchweg
Deutsche,
meist
aus
dem
Kölner
Raum.
Die
Forcierung
des
Konzeptes
„Citroën“,
Made
in
Germany,
hat
gewichtige
Gründe,
wirtschaftliche,
politische
und
psychologische.
Der
1918
zu
Ende
gegangene
und
verlorene
Weltkrieg
I
zeigt
allenthalben
noch
seine
Nachwehen.
Einheimischen
Au-tomobilherstellern
geht
es
schlecht,
ausländische
Konkurrenz
ist
gefürchtet,
der
Staat
schwingt
die
Keule
horrender
Schutzzölle
auf
Importgüter.
„Deutsche,
kauft
deutsche
Wagen!“,
dröhnt
1925
der
Appell
von
Plakaten
des
Industrie-Reichsverbandes
an
den
Litfaßsäulen.
Was
wäre
logischer
für
die
Citroën Automobil AG als das Bemühen, diesen Gegenwind durch möglichst intensive „Germanisierung“ ihrer Produkte zu un-terlaufen ?
Dem
Typ
B
14,
einem
ungewöhnlich
preiswerten,
zuverlässigen
und
komplett
ausgestatteten
Alltagsauto
der
(wie
man
heute
sagen
würde)
unteren
Mittelklasse,
folgt
1928
der
C
4.
Zugleich
steigt
Citroën
Deutschland
mit
dem
Sechszylindermodell
C
6
ins
Segment
der
größeren
Reisewagen
ein.
Besonders
erfolgreich
entwickelt
sich
nun
das
Geschäft
mit
Taxen.
Citroën
gehörte
übrigens
damals
in
Europa
zu
den
Pio-
nieren der Ganzstahlkarosserie.
Was
noch
bemerkenswert
ist:
Im
Köln-Poller
Werk
gibt
es
keine
umfangreiche
Lagerhaltung
für
Teile
und
Materialien
mehr.
Angelieferte
Rohstoffe
und
Aggregate
werden
portionsweise
direkt
an
die
Handlager
längs
der
Fertigungsbänder
weitergeleitet.
Just-in-time-System
also schon vor 90 Jahren !
In
der
bereits
1928
in
Berlin-Halensee
erworbenen
Immobilie
gestaltet
1930
Citroën
ein
repräsentatives
Anwesen
und
etabliert
dort
die
Verwaltung
und
die
Vertriebszentrale.
Über
350
deutsche
Vertragshändler
werden
von
hier
aus
betreut
und
beliefert.
Schon
vorher
gibt
es
an der berühmten Prachtstraße „Unter den Linden“ einen Verkaufssalon - einen der luxuriösesten von ganz Spree-Athen.
Der
Produktionsbetrieb
bleibt
in
Köln.
Ständig
neue,
verbesserte
Modelle
und
Varian-ten
(deren
Entwicklung
und
Konstruktion
natürlich
weiterhin
Sache
von
Paris
ist)
ver-lassen
die
Fließbänder.
Gleichwohl
hat
das
Unternehmen,
wie
andere
in
der
Branche
auch,
alsbald
mit
enormen
Schwierigkeiten
zu
kämpfen,
bedingt
durch
diverse
Wirtschaftskrisen.
Das
Jahr
1932
beschert
der
deutschen
Citroën
AG
ein
Rekord-Tief.
Durch
Produktion
Leichter
Transporter
und
europaweitem
Vertrieb
der
in
Köln
hergestellten
Kegresse
-
Kettenfahrzeuge
werden die Fertigungsdefizite teilweise ausgeglichen.
Besser wird es wieder in 1933:
Da
erscheint
die
Typenreihe
8
A,
10
A
und
15
A,
populärer
Beiname
„Rosalie“.
Am
Rhein
nennt
der
Volksmund
sie
ebenso
liebevoll,
wenn
auch
weniger
klangschön
“die
Poller“,
wie
alle
hiesig
gefertigten.
Eben
weil
sie
in
Poll
fabriziert
werden,
und
zwar
praktisch
total
aus
deutschen Werk-stoffen und Zulieferteilen. Die Vierzylindermotoren des Typs 8A bezieht man zum Beispiel bei Siemens & Halske in Berlin.
Die
von
Anno
„1925“
stammende
eingangs
zitierte,
teutonisch-markige
Werbeaussa-ge
spricht
Bände
über
das
Klima
in
unserem
Land
bereits
am
Vorabend
der
NS-Diktatur
und
die
geradezu
verzweifelten
Klimmzüge
von
Citroën,
den
deutschen
Markt
dennoch
für
sich
zu
retten.
Es
gelingt
nur
vorübergehend.
Als
Hitler
an
die
Macht
kommt
gehen
die
Schikanen
gegen
„fremdländische“
Erzeugnisse
weiter
und
die Übergriffe gegen ihre Käufer nehmen zu.
Und zu allem Überfluß gerät auch Firmenpatron André Citroën an der Seine finanziell im kritisches Fahrwasser.
Aber noch einmal landet der große Mann des kreativen Automobilbaus einen sensationellen Coup...
1934: Zieht der Frontantrieb das Unternehmen wieder nach vorn ?
Von
Kopf
bis
Fuß
neu
konstruiert,
in
Technik
und
Karosserieform
überwältigend
fort-schrittlich,
tritt
der
Citroën
Typ
7C
auch
im
August
1934
in
Deutschland
an:
Die
erste
Version
des
legendären
Traction
Avant,
in
Deutschland
„Front“
genannt
,
später
wegen
seiner
Mitwirkung in französischen Banküberfällen und auch Kriminalfilmen unter Jean Gabin mit dem Spitznamen „Gangsterwagen“ belegt.
Als
Typ
11
CV
und
Vierzylindern
beziehungsweise
15-SIX
als
Sechszylinder
bleiben
diese
Frontantriebler
bis
weit
in
die
Fünfziger
Jahre
hinein
in
Europa
berühmt
und
begehrt.
Auch
der
Traction
Avant
rollt
fast
komplett
„Made
in
Germany“
aus
den
Werkstoren
in
Köln-Poll.
Doch leider nicht lange.
1935: Der gnadenlose politische Würgegriff zwingt zur Aufgabe
Das
NS-Regime
steigert
ständig
seine
Kampagnen
und
bürokratischen
Aktivitäten
zur
Vergräulung
ausländischer
Unternehmensfilialen
im
Reich.
Drastische
Handelskontrollen,
Behinderung
von
wirtschaftlichen
Kontakten,
verweigerte
Einfuhrgenehmigungen
für
Teile
und
Werkzeugmaschinen..... der Standort Deutschland wird nachgerade unhaltbar.
Ab
Herbst
1935
ruhen
bei
Citroën
in
Köln
die
Fließbänder,
man
kann
nur
noch
fertige
Autos
importieren,
und
dies
in
erzwungenermaßen
spärlicher
Stückzahl.
Die
Berliner
Zentrale
macht
dicht.
Was
in
Poll
am
30.
Januar
1936
schließlich
übrigbleibt,
ist
ein
Reparaturbetrieb
mit
Ersatzteildepot. In Frankreich stirbt André Citroën.
1940 Ein bitteres Ende, das zehn Jahre dauern soll !
Der
Weltkrieg
II
tobt
in
Europa.
Das
Wehrkreiskommando
beschlagnahmt
1.
September
1939
das
Kölner
Werksgelände
als
„Feindvermögen“
und
errichtet
darauf
einen
Reparaturbetrieb
für
Panzer
und
auch
noch
eine
U-Boot
Motorenfertigung.
Die
Geschäftstätigkeit
von
Citroën
Deutschland
erlischt
nun,
denn
im
Oktober
1944
legt
ein
Luftangriff
den
gesamten
Komplex
in
Schutt
und
Asche.
1950: Comeback a`Cologne
Kurz
nachdem
man
am
6.
Dezember
1950
die
Zwangsverwaltung
der
Citroën
AG
aufhob
ist
natürlich
Köln
wieder
der
Ausgangspunkt.
Im
„Maison
Belge“,
einem
tradi-tionellen
belgischen
Kultur-
und
Handelshaus
im
Herzen
der
Domstadt,
bezieht
die
neu
aus
der
Taufe
gehobene
Citroën
Automobil
AG,
Verkaufsgesellschaft
für
Deutschland,
ihr
kleines
Büro.
Man
organisiert
später
von
der
Sülzburgstraße
in
zunächst
bescheidenem
Umfang
den
Import
und
Vertrieb
von
Traction-Avant-Modellen
aus
Frankreich.
Etwa
30
Treue
alte
Partner
der
Vorkriegszeit finden sich ein zur allmählichen Auferstehung des Händlernetzes.
Das
Provisorium
im
„Maison
Belge“
währt
bis
1952.
Dann
ist
Citroën
in
Köln
wieder
Herr
im
eigenen
Haus,
und
zwar
einem
vergleichsweise
großzügigen
Gebäudetrakt
an
der
Aachener
Straße.
Er
beherbergt
Geschäftsleitung
und
Vertrieb,
Verkaufsräume,
Werkstatt und Ersatzteildepot.
Das berühmte Westdeutsche Wirtschaftswunder mit seinen mittlerweile in 1957 fünfzig Haupthändlern gewinnt an Fahrt.
Ein
Frust
jedoch
soll
noch
lange,
nämlich
bis
1958,
die
germanische
Doppelwinkel-Diaspora
plagen:
Obwohl
drüben
in
Frankreich
schon
seit
1949
gebaut
und
vermarktet,
ist
der
2
CV
hierzulande
nicht
lieferbar.
Er
wird
von
den
Galliern
so
frenetisch
begehrt,
daß
für
den
Export kein Stück übrig bleibt. Nur seinerzeit ergattern Bundesbürger via Privat-Import auf eigene Faust eine Ente.
1956: Die „Göttin“ und ihre frühesten deutschen Anbeter
Ein Jahr nach seiner Premiere auf dem Pariser Salon wird das futurische, in Technik und Styling schockierend neuartige Modell DS 19 mit
hydropneumatischer Federung auch den Deutschen feilgeboten. Die Fachwelt von Flensburg bis Garmisch steht Kopf.
Einer der ersten begeisterten Fahrer einer „Deesse“ ist Heinrich Böll, der Kölner Dichter und spätere Literatur-Nobelpreisträger. Das D-
Modell wird, in vielfachen Verbesserungsstufen, bis 1975 gebaut, gekauft und geliebt werden...
1959: Wieder ein Umzug, Porz wird „Citroën-Ville“
Auf
einem
108.710
Quadratmeter
großen
Industriegelände
in
Porz-Westhoven,
knapp
zehn
Kilometer
von
Köln
entfernt,
etabliert
sich,
im
Tausch
gegen
die
ehemalige
Poller
Immobilie,
die
deutsche
Citroën
-
Zentrale
endgültig.
Das
Anwesen
Aachener
Straße
wird
Niederlassung.
Rund
200
Mitarbeiter
stehen
jetzt
in
Diensten
der
Firma.
85
Vertragshändler
kümmern
sich
im
Bundesgebiet
um
Verkauf
und Service.